Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident – ja, das auch. Das waren schon viele. Wenige aber griffen gleichzeitig in die Tasten wie ich. Und wie! Nach meiner eigenen Berechnung veröffentlichte ich in jener Zeit 32 Kolumnen, einige Artikel zu Sachthemen sowie einen sehr grundsätzlichen Text zum Wesen der Zeitung schlechthin. Im Rückblick entsprach es einem furor publicandi, was ich kurz vor und nach der Übernahme des Verwaltungsratspräsidiums im Jahre 2010 veranstaltete, ein Feuerwerk, als ob ich zu beweisen hätte, dass nicht nur sie, die ordentlichen Mitarbeiter der NZZ, schreiben könnten, sondern dass auch der designierte und dann tatsächlich präsidierende Leithammel „es“ kann. Etwa so, wie sich weiland, als es in der Schweiz noch Regimente gab, ein angehender Kommandant unter die Grenadiere mischte und an vorderster Front, mit geschwärzt-grimmigem Gesicht natürlich, die Gefechtsübung mitabsolvierte, um fortan, als einiger der ihrigen anerkannt, unangefochten vorangehen zu können. Als „Troupier“, wie man damals sagte.
Eine etwas romantische Vorstellung einer Führungsfunktion, mag man aus abgeklärter Sicht moderner Governance-Erkenntnisse vorwerfen. Oder auch ein gerüttelt Mass an Naivität, wenn man an das trübe Biotop einer realexistierenden Redaktion denkt, wo sich Haifische, Delphine, Muränen, Egli, Forellen, Karpfen und Amöben zugleich tummeln: einer der ihren – denkste! Da sind Grenadiere in der Regel schon ein wenig einfacher strukturiert. Wenn es schon kaum einem Ressortleiter, geschweige denn einem Chefredaktor gelingt, wirklich eine sichtbare Linie in die von ihm verantwortete Publizistik zu bringen, was soll da denn ein Verwaltungsratspräsident ausrichten? Er wird scheitern müssen.
Ist er auch, aber an einem anderen Umstand.
Die Jahre 2010 und 2011 waren ideal für einen Kolumnisten. Noch brodelte die Finanzkrise, standen Banken am Abgrund, stotterte die Weltwirtschaft. Griechenland wurde zur echten Gefährdung der europäischen Finanzstabilität und drohte ähnlich gelagerte Länder wie Italien, Spanien und Portugal in den tiefroten Schlund niemals mehr rückzahlbarer Staatsschulden zu ziehen. In der EU spannte man einen Rettungsschirm über den anderen auf, Deutschland wurde zum lender of last resort eines ganzen Kontinents und nahm dieses Schicksal, weil angeblich alternativlos, ergeben an. Strauss-Kahn qualifizierte sich als early bird der späteren MeToo-Bewegung. Anders Behring Breivik richtete ein grauenhaftes Blutbad auf der norwegischen Insel Utoya an, und Silvio Berlusconi küsste den Ring von Muammar Gaddafi.
Stoff genug für den skeptischen Beobachter aus der Ostschweiz! Und wenn einmal die Aktualität nichts Passendes hergab, dann weidete er sich am Sprachgebrauch junger Damen im Zürcher Tram („voll- bzw. megageil“) und sang im Angesicht solcher Wortschöpfungen das Hohelied des spontanen Entstehens einer neuen Ordnung im Hayek’schen Sinn. Oder er sprach den Enkelinnen der Burka- und Regenmäntel tragenden muslimischen Pinguine sein Vertrauen aus, indem er spätestens für ihre Generation ein Einlenken in westliche Modeusanzen voraussagte. Bikinis statt Burkas, so die Prognose; das entsprach einer Steilvorlage gegen das Burkaverbot. Sogar die in unserem Lande so beliebten „Themenwege“, Käseweg hier, Murmeliweg da, fielen der spitzen Feder zum Opfer, ebenso der Schweizer Bundesrat, der als das „unkooperativste Gremium des Landes“ bezeichnet wurde.
Nun, Redaktionen räumen ihren externen Kolumnisten generell grosse Freiheiten ein. In der Rückschau staune ich jedoch über das Mass an laisser-faire, das man dem nicht ganz externen Mitarbeiter/Verwaltungsrat/Verwaltungsratspräsidenten gegenüber gewährte. War es echte Liberalität der Involvierten oder lediglich stilles Erdulden einer als unvermeidlich eingeschätzten Gegebenheit? Wir wollen hier nicht urteilen. Die Tatsache aber, dass an der Falkenstrasse Zürich nebst vielem anderem auch so etwas möglich war, spricht für die Institution und ihre Elastizität im Umgang mit Ungewöhnlichem.
Nun gibt es im Verlagswesen zwar den schreibenden und redigierenden und regierenden Herausgeber, aber im Fall der „AG fürdie NZZ“, wie sie bezeichnenderweise heisst, ist die Funktionentrennung deutlich vorgegeben: Hie die inhaltlich Orientierten, da die Betriebswirtschaftlichen, und der Verwaltungsrat beziehungsweise deren Präsident gehört ganz sicher zu letzterer Seite. Ansonsten wäre die Unabhängigkeit der Zeitung gefährdet, so die Auffassung. In ähnlicher Situation befand ich mich als Bankrat der Schweizerischen Nationalbank. Jegliche Versuche zu einem auch nur geringfügigen Übergriff der vorgesetzten obersten Behörde auf das Inhaltliche beantwortete das für die Geldpolitik verantwortliche Direktorium mit der Bisshemmung von Kampfhunden. Der ganze Rest der Wirtschaft allerdings, alle Millionen anderen Unternehmungen sind genau anders organisiert: Die Spitze und gerade die Spitze ist auch und vor allem für das zuständig, was von der Unternehmung konkret produziert wird. Wer denn sonst? Die NZZ als eine Art Notenbank – so war und ist möglicherweise immer noch die Sicht auf diese sehr besondere Unternehmung.
Nur: Nichteinmischung ist eben meine Sache nicht, und so ging ich noch einen Schritt weiter und kratzte mit Absicht am Redaktionsstatut, in welchem die Unabhängigkeit der NZZ-Redaktion in Marmor, nein, besser Gotthardgranit gemeisselt ist. Dazu nahm ich mir die Antrittsansprache bei meiner ersten Generalversammlung als Präsident im Jahr 2011 vor. „Im Zweifel für die Freiheit“ lautete der Titel dieser programmatischen Rede, die dann im Wortlaut in der darauffolgenden Woche auch noch im Blatt veröffentlicht wurde. Darin statuierte ich den inhaltlichen Primat des Verwaltungsrats. Zwar dürfe dieses Gremium unter keinen Umständen in einzelne publizistische Problemstellungen eingreifen. Hingegen liege die strategische und mithin weltanschaulich-politische Ausrichtung genau im Verantwortungsbereich des Verwaltungsrats, und sein Führungsmittel liege in der Personalpolitik, beschränkt allerdings auf die eine und entscheidende Person, jene des Chefredaktors. Der Verwaltungsrat könne sich nicht davor drücken, laufend und mit periodischer Vertiefung seine Oberverantwortung für das Inhaltliche anhand der Frage, ob der Chefredaktor der richtige sei, wahrzunehmen. In allen Jahren zuvor, während denen ich Mitglied im Verwaltungsrat gewesen war, war kein einziges Mal vom Inhalt der Zeitung die Rede gewesen, oder höchstens „hors séance“. Was mir vorschwebte, war ein regelmässiges Assessment der Content Factory NZZ auf dem Wege der Personalpolitik auf höchster Ebene.
Im weiteren gab ich auch in jenem Grundsatzreferat noch ein paar Ratschläge an die Redaktoren weiter. „Im Zweifel für die Freiheit“ war eine Art Vademecum für schwierige Entscheidungssituationen, vor die man im täglichen Umgang mit konkreten Sachverhalten unumgänglich gestellt wird. Wie rasch fällt doch auch der stramm Liberale den Verlockungen des „öffentlichen Interessens“ und der „übergeordneten Überlegungen“ zum Opfer! Diese Metaebene des Unkontrollierbaren-Kollektiven geniesst die Vermutung überlegener Moralität, das Individuum unterliegt demgegenüber als Hort von Eigennutz. Und wie oft nimmt auch der vermeintlich Liberale das Unwort des Marktversagens in den Mund und ruft nach (zusätzlicher) Regulierung und Kontrolle!
Was war die Absicht? Ich wollte für die stipulierte strategische, weltanschaulich-politische Ausrichtung einen leicht verständlichen und unangreifbaren Benchmark setzen, der generell genug formuliert war, um nicht als konkrete Verletzung der redaktionellen Freiheit taxiert zu werden. Denn schliesslich muss, so meine Meinung, ein Chefredaktor wissen, was sein vorgesetzter Verwaltungsrat richtig und was er falsch findet. Ein Assessment ohne Messlatte ist sinnlos beziehungsweise droht im Episodischen gerade vor kurzem aufgefallener Artikel steckenzubleiben.
Ja, ich war ein schreibender NZZ-Mitarbeiter. Aber eigentlich ging es um etwas ganz Anderes. Ich spürte schon seit langem – und spüre heute noch – einen Zeitgeist- und Technologie-induzierten Megatrend in Richtung Distribution, Distribution und nochmals Distribution, währenddem das Inhaltliche sich laufend und immer noch auf dem Rückzug befindet. Hand aufs Herz: Worin unterscheiden sich heute die Tageszeitungen noch? Lesen wir nicht einfach überall dieselben Sachverhalte immer wieder, wohl ein wenig anders aufgemacht, aber in Bezug auf ihren Gehalt im wesentlichen deckungsgleich? Welche Redaktion lässt sich nicht durch das Kampagnenmanagement von Bundesämtern, die ein Thema irgendwelcher Art lancieren wollen, vor den Karren spannen? Wie weit sind wir wirklich entfernt von der Staatspropaganda, wie sie weiland in der DDR praktiziert wurde? Eine gewisse Differenzierung im Inhaltlichen findet sich eigentlich nur noch auf den Meinungsseiten, der Rest ist Einheitsbrei.
Dem wollte ich mich entgegenstellen. Durch bewusste und provokative Überbetonung des Inhaltlichen. Distribution, das kann man organisieren oder einkaufen. Echte, überraschende, authentische Inhalte beruhen demgegenüber zwingend auf intellektueller Eigenleistung. Die NZZ hat es bis anhin geschafft, im Schlund der Distributionsmanie nicht gänzlich aufgesogen zu werden. Man wurde, nach geraumer Bedenkfrist zwar, auch wieder eine distributionswütige Führungskraft wieder los, die Österreich als Zielland für die Weiterverbreitung des ewig Gleichen erkoren hatte. Solcherlei erfreut, denn es braucht Mut, blendende Manager in die Wüste zu schicken.
Distribution wird bald einmal Schnee von gestern sein. Nämlich dann, wenn die Informations- und Transaktionskosten sich ganz generell der Nulllinie angenähert haben werden. Alles spricht dafür, dass dieses Race-to-the-Bottom gelegentlich einmal vorüber sein wird. Wenn alles ohnehin gratis zu haben ist, dann schlägt die Stunde jener, die produzieren können, was noch niemand hat. Die Technologie wird dafür sorgen, dass solcherlei Inhalte nicht mehr zu den öffentlichen Gütern gezählt werden müssen, sondern zu den privaten – weil sie sich nach Lektüre sofort selber, im Sinne eines smart contracts, in Luft auflösen und höchstens vom wahren Eigentümer noch einmal aufbereitet werden können. Wer dann Inhalt herzustellen in der Lage ist, wird wohl weitere 150 Jahre überleben. Und nicht nur das: auch gut davon Leben. Ich bleibe deshalb Aktionär der AG für. Ist ja auch eine Art Mitarbeit.
Erschienen in der NZZ Sonderpublikation zum 150 Jahr Jubiläum, 14.4.2018




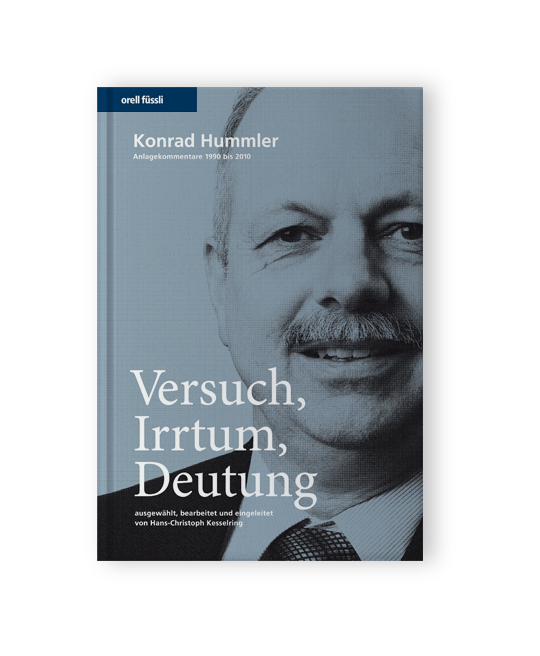




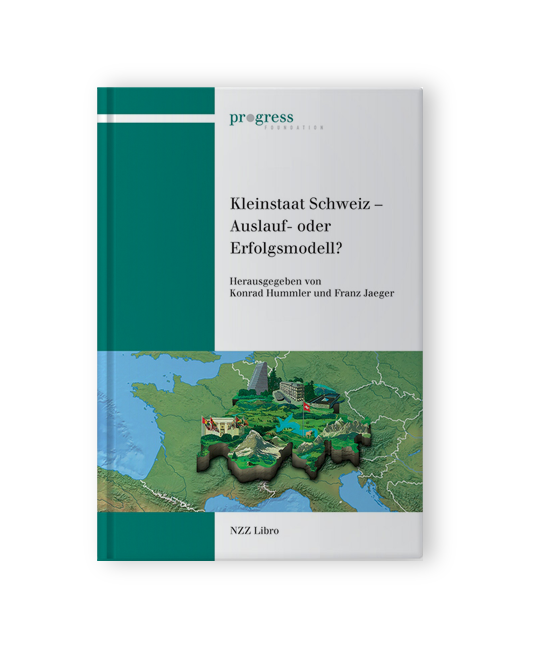


 Zur Übersicht
Zur Übersicht