„Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen; aber Tröstungen erquicken meine Seele.“
I.
Ja – wenn es dann einmal soweit sein soll, dass ich Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werde, dann schon am liebsten genau so: Wie der atemberaubende Schluss dieser Kantate, entfesselt, unbekümmert, frei von Zweifeln, vielstimmig-einstimmig jubelnd. Johann Sebastian Bach reisst uns in einer beispiellosen Steigerung aufwärtswirbelnder Kaskaden von den Kirchenbänken und offenbart damit seine eigene Apotheose. Dass Bach der fünfte Evangelist sei, diese Aussage kommt wahrlich nicht von ungefähr. Ähnlich fesselnde musikalische Momente – es gibt deren viele, wie es unsere langjährigen Konzertbesucher schon mehrfach erlebt haben – sie bestätigen die gewagte Qualifikation durchaus. Bach war als ganz gewöhnlicher Mensch aber in der objektiv und subjektiv gegebenen Tristesse der menschlichen Realität genügend verortet, dass er die Begegnungen mit Gott auch dunkel, seufzend, klagend, weinend, zagend, fordernd, zürnend, ermattet und ergeben darzustellen gedrängt war. Die vorliegende Kantate ist in meinen Augen eine der vollständigsten Abfolgen von unterschiedlichsten Empfindungen, wie sich ein Mensch im grossen Gegenüber fühlen kann. Von unendlich elend und verlassen bis zu unendlich befreit und glücklich. Dichte Musik! Wert, sie an einem Abend doppelt aufzuführen…
II.
Ich werde als Gründer und Präsident der Johann Sebastian Bach- Stiftung oft nach meinem Verhältnis zum Glauben gefragt. Die einen möchten mir ein vorbehaltloses Bekenntnis abringen, die anderen wollen mich ihrem philosophisch-existentialistischen Lager zuordnen. Es geht um die «Gretchenfrage», wie es vor 6 Monaten an dieser Stelle Hans Magnus Enzensberger formulierte und bei der Gelegenheit allem Kategorischen, darunter dem Atheismus, eine Absage erteilte. Es erstaunt mich immer wieder, wie apodiktisch diese Gretchenfrage vorgetragen wird, wie hoch die Erwartungen gesteckt sind, aufgrund der Antwort die Welt noch besser in Freund und Feind einteilen zu können. Dabei wären doch gerade hier Schattierungen und Farbtöne aller Art am Platz – und Raum für Skepsis, Zweifel oder eben auch stilles Gottvertrauen. Hinter manch laut geäussertem Bekenntnis und auch manch philosophisch verbrämter Wortanhäufung versteckt sich nicht selten mangelndes Können oder Wollen zu eigener metaphysischer Beschäftigung. Sie ist eben anstrengend, die metaphysische Beschäftigung, hat viel mit Bekümmernis zu tun, und sie will so ganz und gar nicht in die heutige Zeit der unbegrenzten technischen Möglichkeiten und der schrankenlosen Machbarkeit passen. Neuerdings sollen wir nun also ewig leben können. Die Technik sei in der Lage, den Tod zu bannen… Vielleicht wäre es eher die grassierende metaphysische Nichtbeschäftigung, die Anlass zu Bekümmernis sein müsste!
III.
Ich glaube, dass ich es als Glück, oder wenn Sie wollen, als Segen bezeichnen darf, mittlerweile ein ziemlich ungestörtes Verhältnis zur Gottesfrage zu haben. Dabei hätte es auch anders kommen können. Meine Mutter pietistischer Herkunft drängte uns Kinder zu einem relativ engen, dem religiösen Eifer nicht ferne stehenden Glaubensleben. Mein Vater liess sich dagegen kaum in die Karten blicken und markierte höchstens den agnostischen Stoiker. Noch war in meiner Jugend der zweite Weltkrieg mit seinen abgrundtiefen Greueln zu prägnant, als dass man ohne sehr berechtigte Vorbehalte von einem allmächtigen Gott oder gütigen Vater hätte reden können. Das vollmundig-begeisterte «Gott ist die Liebe» der Sonntagsschulzeit erstarrte im Erkenntnisschub meiner Adoleszenz. Die Lektüre von Celan, Nietzsche und Camus war darauf angelegt, letzte religiöse Regungen ersticken zu lassen. Da half auch der wohlgemeinte Konfirmandenunterricht des Linsebühlpfarrers nichts.
Wäre da nicht mein gefürchteter Mathematiklehrer gewesen, der zur Auflockerung zwischen allen algebraischen und geometrischen Krisen einigen aufgeweckten Schülern die Möglichkeit bot, Vorträge über mathematische Grundfragen und Persönlichkeiten zu halten. Ich wählte den deutschen Mathematiker, Logiker und Philosophen Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925), der als erster eine formale Sprache und, damit zusammenhängend, formale Beweise entwickelte. Er beeinflusste Denker wie Rudolf Carnap, Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein. Frege beschrieb die Logik nicht nur abschliessend und wendete sie an, sondern stiess an ihre Grenzen und überschritt sie ungewollt. 1902 wies ihn Bertrand Russell auf einen unlösbaren Widerspruch hin, nämlich die sogenannte Russell’sche Antinomie. Sie besagt, dass die Menge aller Mengen sich nicht selber beinhalten kann oder aber nicht die Menge aller Mengen sein kann.
So, wie 1902 Russells Brief den Kollegen Frege in höchste Bekümmernis stürzte, weil dieser sein Lebenswerk der unzweideutigen Darstellung der Logik als gescheitert betrachten musste, so wurde die Lektüre dieser Literatur für mich zum turningpointmeiner Weltsicht. Russells Antinomie wurde nie befriedigend aufgelöst. Seither gilt als gegeben, dass die menschliche Logik Grenzen hat. Ich vermutete bald einmal, dass das Endliche das Unendliche nicht adäquat beschreiben kann, und stiess einige Jahre später, im Zuge der Arbeiten für meine weitgehend formallogische Dissertation, darauf, dass mit binärer Ja/Nein-Logik Werturteile nicht gefällt werden können, sondern bestenfalls beschrieben, emuliert. Noch später lehrte mich der grosse Mathematiker Benoît Mandelbrot, den ich persönlich kennenlernen durfte, dass ein Fehler immer grösser und gewichtiger wird, je genauer man misst, je genauer man kontrolliert und korrigiert und je mehr man ihn zu vermeiden versucht. Aus der tiefen Bekümmernis über das inhärente Kontrolldefizit der Menschen fand ich nur durch die ausserhalb aller Logik stehende Annahme, dass es da doch noch etwas Höheres, etwas Überirdisches geben müsse, das Logik und Widersprüche in sich aufhebt, das umfassend zu verstehen uns unmöglich ist und das wir höchstens auf die eine oder andere Art erahnen können.
Ohne die Ahnung dieses übergeordnet Unfassbaren wäre die Welt für mich in jeder Hinsicht hoffnungslos leer und trostlos geworden und geblieben. Etwa so, wie es jene Abdankungsrituale sind, an welchen, statt Gottesdienst gefeiert, das Andenken an den Verstorbenen zelebriert wird. «Du wirst für immer in uns weiterleben!», wird jeweils feierlich beteuert. Und die Leute merken nicht einmal, dass sie gerade einer Instant-Reinkarnationslehre auf den Leim gekrochen sind. Am Schluss aber, weil es eben ganz ohne Gott doch nicht geht, wird dann doch noch ein verdrücktes «Vater-unser» gemurmelt. Es ist so: Die Welt der Gottesleere hat noch nicht zu ihren Ritualen gefunden. Vielleicht wird sie es nie können. Weil halt doch etwas fehlt.
Ich bin natürlich weit davon entfernt, mit der Begrenztheit menschlichen Vermögens den Gottesbeweis antreten zu wollen. Wo die Logik an ihr Ende kommt, ist der «Beweis» ja ohnehin inhaltslos. Aber gerade deshalb meine ich, dass die freudige Annahme der Existenz einer das Unendliche und damit Unfassbare bedeutenden Instanz im realen Leben sehr hilfreich ist. Unsere Bekümmernisse sind nicht alles, sie sind nicht das Letzte. So relativiert sich vieles. Vor allem die Anmassung von Macht, der wir, im Grossen des Weltgeschehens oder auch im kleinen Mikrokosmos unserer engeren Lebensverhältnisse, notorisch ausgesetzt sind. Die Figur von Jesus ist für mich deshalb zentral, weil von ihr die ultimative Ablehnung jeglicher Machtanmassung ausgeht. Macht – letztlich heisst das immer zwischen Menschen praktizierte Erpressung, Wegnahme, Wegschliessung, Folter, Tötung – ist dieUrsache für Bekümmernis schlechthin. Die Idee der völlig ausgelieferten, gefolterten und getöteten Gottheit ist und bleibt der, wie man will, skandalöse oder auch grandiose Gegenentwurf zur primitiven Machtfigur Mensch. Der Glaube an die Auferstehung aus dieser göttlich inszenierten Ohnmacht ist so gesehen der eigentlich einzig denkbare Trost für dieses abgrundtiefe und finstere Tal der Bekümmernis.
IV.
So gehe ich denn verhältnismässig heiter durchs Leben. Mein Glaube ist ziemlich agnostisch, das heisst, ich lasse mich nicht weit auf die Äste hinaus, wie «es» sich denn genau verhalten könnte. Theologisch verbrämte Sophisterei ist mir ein Greuel, und ich mag über den sogenannt «richtigen» Glauben nicht streiten. Ja, ich meine, von der priesterlichen Anmassung her, in Glaubenssachen recht zu haben, stamme das meiste Übel dieser Welt. Ich halte mich lieber an Huldrych Zwinglis ganz schön tautologischen Satz: «Glaube ist dieses Wesentliche und Feste in unseren Seelen, das von jenem gegeben ist, der selber Grund und Inhalt unserer Hoffnung und deren Erwartung ist» (aus der Abhandlung «Die Vorsehung» von 1530). Im Lichte der Annahme eines immer noch Grösseren, noch Umfassenderen, löst sich die Tautologie logisch auf.
Weshalb lässt sich auf diese Weise leichter, unbekümmerter durchs Leben gehen? Erstens, weil ich nicht hinter allem, was auf dieser Welt geschah und geschieht, einen Plan Gottes vermuten muss. Meine relativ agnostische Sicht lässt Eigenständigkeit, Eigenverantwortung, Zuneigung, Zufälle, Schicksalsschläge, abgründige Gemeinheiten und Scheusslichkeiten unter Menschen zu. Sie gehören zu der ihm, dem Menschen, verliehenen Gottähnlichkeit und der damit verbundenen Verantwortung für sein Tun und Lassen. Aber ich glaube: Es ist nicht alles, es ist nicht das Ende. Am Schluss obsiegt die Nicht-Macht, die Liebe.
Zweitens: Gemessen am Unendlich-Unfassbaren kann auch leichter mit neuen und vielleicht auch einmal unpassend erscheinenden menschlichen Erkenntnissen umgegangen werden. Was tut es dem Ozean, wenn sich ein neues Bächlein in ihn ergiesst?So gehe ich mit den Schriften der neuzeitlichen Propheten, der grossen Philosophen und Schriftsteller von Kant über Nietzsche bis Camus und Heidegger recht gelassen um. Ja, sie hören recht. Ich stufe die Philosophen der Aufklärung oder auch des Existentialismus als eine andere Art von Propheten ein. Zum einen ist ohnehin nicht einzusehen, warum es solche nach Christus nicht mehr geben soll. Zum anderen ist es eben schon so: Nach dem, was sie geschrieben haben, muss man anders über Gott denken und reden als zuvor. Aber Ozean bleibt Ozean, so anregend, vielleicht auch ätzend die Bächlein sein mögen. Ähnlich gelassen bleibe ich auch angesichts der neuesten Blüte menschlicher Erkenntnis, der künstlichen Intelligenz (AI). Auch dieses Gewässer wird das Meer der Unendlichkeit nicht voller machen.
Drittens: Dann und wann öffnet sich für uns ein ganz klein wenig der Himmel. Wer aufmerksam durch sein Leben geht, macht solche Erfahrungen, da sich die Luken unserer seltsamen Lebensarche ein wenig öffnen und einen Blick auf den alles versöhnenden Regenbogen zulassen. Nämlich dann, wenn Engel unseren Lebensweg kreuzen. Der ziemliche Agnostiker Hummler ist mittlerweile tolerant geworden gegenüber der Idee von Gesandten aus höherer Mission. Früher hätte ich die Vorstellung weit und energisch von mir gewiesen. Aufgrund eigener Lebenserfahrung bin ich aber etwas vorsichtiger geworden. Wie war es damals, als der junge Familienvater in der Südwand des 4. Kreuzberges in Richtung Rheintal stürzte? Das grasige Bödeli kam gerade rechtzeitig, es liess eine Notlandung zu, als hätte ein Schutzengel gesagt: Nein, Konrad, das ist noch zu früh, du musst noch das eine oder andere erledigen. Oder wie war es kürzlich, als die betagte Schwiegermutter in Holland plötzlich im Sterben lag und für meine Frau und mich jede Minute zählte, um von ihr noch Abschied nehmen zu können? Alles fügte sich, wie von unsichtbarer Hand geleitet, zum Guten: Von freien Sitzplätzen im Flugzeug über den zu frühen Start und die zu frühe Landung, das schon fahrbereite Mietauto bis zur Abwesenheit von Staus auf den sonst notorisch verstopften holländischen Autobahnen. Mutter lebte noch eine halbe Stunde nach unserem Eintreffen, ihr Sterben, ein erleichtertes Aushauchen des Lebens, brachte mir die Erkenntnis ein, dass der Tod etwas Schönes sein kann. War eine Häufung von Zufällen im Spiel? Mag sein. Dann sind Zufälle halt auch Engel.
Meistens aber sind es Menschen wie Du und ich, weit davon entfernt, im normalen Leben Engel zu spielen. So etwa der greise Filmproduzent Arthur Cohn, der mir auf dem Höhepunkt der Wegelin-Krise, als ich vom Präsidium des NZZ-Verwaltungsrats verdrängt wurde, out of the blue (wir kannten uns zuvor überhaupt nicht) drei asiatische Glückselefanten überbrachte und mir zuraunte: «Es wird gut kommen, Herr Hummler.» Oder Peter Sloterdijk, hauptberuflich alles andere als ein Engel, bewahre!, der mir anderthalb Jahre später in Leipzig den Myschkin-Anerkennungspreis an der Seite von Noam Chomsky verlieh und mich mit dieser unerwarteten Geste in meinem Willen, fürs Bachprojekt durchzuhalten, wesentlich bestärkte. Oder diese Lichtfigur einer leukämiekranken jungen Frau, die trotz mehrerer dramatischer Nahtoderlebnisse und fürchterlichster Lebenserfahrungen ihren Mitmenschen – unsere Familie gehört dazu – laufend Lebensmut vermittelt. Als Vorbild von Zuversicht in höchster Bekümmernis!
Was tun denn Engel besonderes? Sie lassen gnädige Fügungen zu, vermitteln Mitmenschlichkeit und Liebe, wo das gerade nicht zu erwarten wäre, geben den richtigen Anstoss dort, wo man selber nicht mehr weiterkäme. Out of the blue, wie unverdientes Manna vom Himmel. Achten Sie doch darauf: Ihr Leben hat mehr Engel gesehen, als Sie denken. Und seien Sie ihnen ein wenig dankbar.
V.
Ja, und dann gibt es noch die Luken der Musik. Was wären wir in unserer seltsamen und oft sehr dunklen Lebensarche ohne jene Lichtblicke, die uns ein ganz klein wenig jenes Bildes vermitteln, von dem Paulus sagt, dass wir es vorerst nur als Stückwerk erahnen können? Stückwerk, Mosaikteile: aber wenigstens das! Das Geheimnisvolle daran ist: Das Bild ist nicht einfach gleissend-glänzend-goldig. Eben gerade nicht. Also kein überladener Altar, der uns vor lauter Schönheit erschlägt und dessen Pracht am Ende langweilt. Nein, das Bild kennt dunkle Farben und leise Töne. Ja, mir scheint, dass sich die musikalische Gottesahnung zunächst gerade dort einstellt, wo gelitten wird und Angst um sich greifen will, wo Verzweiflung nahe ist und Hoffnungslosigkeit zu herrschen droht. Nichts kann Mit-Leid besser ausdrücken als Musik. Denken Sie an die wunderbare «Erbarme Dich»-Arie in der Matthäuspassion oder – eben – an die Eingangssinfonia der heutigen Kantate. Leid– und wer wollte behaupten, davon gebe es nicht mehr als genug? – ist Teilunseres Gottesbilds, nicht Gegenbild, und genau das macht es so tröstlich. Wenn ich leide, dann leide ich nicht allein.
Aber es bleibt dann nicht beim Leiden. In jeder Komposition des Thomaskantors erfolgt eine Hinwendung zum endgültig Schönen. Bach schafft es wie kein Zweiter, Wallfahrten durch unser seelisches Befinden zu veranstalten und dort anzulangen, wo jeder Einwand, jedes «Ja, aber» verstummt und ein Stücklein himmlischer Herrlichkeit aufblitzt. Ich glaube, Bach wollte bewusst, dass in der heutigen Kantate das Alleluja beinahe zum Lallen verkommt, und ich bin unserem musikalischen Leiter Rudolf Lutz auch dankbar, dass er es so intoniert. Es gibt den Moment, wo nur noch Sprachlosigkeit möglich ist. Und: Der Moment überirdischer Schönheit kann nicht andauern. Wir sind noch im realen Leben; deshalb der abrupte Schluss, den man so schmerzhaft bedauert.
Sprachlosigkeit, Lallen, abrupter Schluss –das ist jetzt. Wir sind begrenzt. Die Welt ist begrenzt. Aber das wird nicht alles gewesen sein. Der Kernsatz der Kantate lautet:
«Die folgend Zeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel.»
Es wird unbegrenzt sein, glaube ich.
3.12.2018/Konrad Hummler
Ich hatte viel Bekümmernis




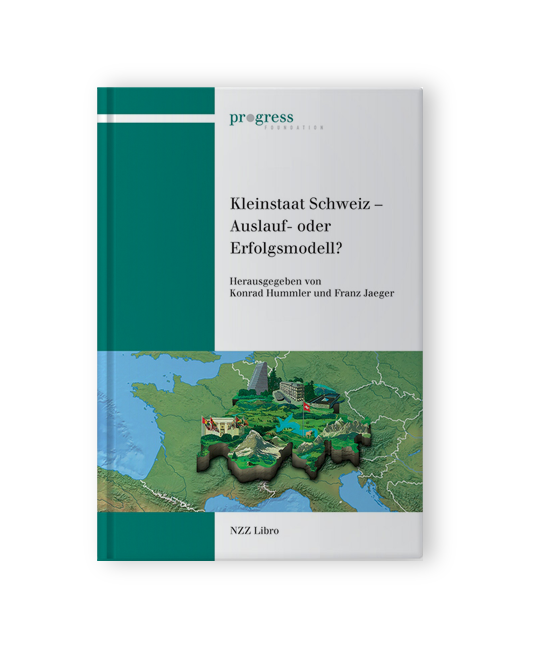

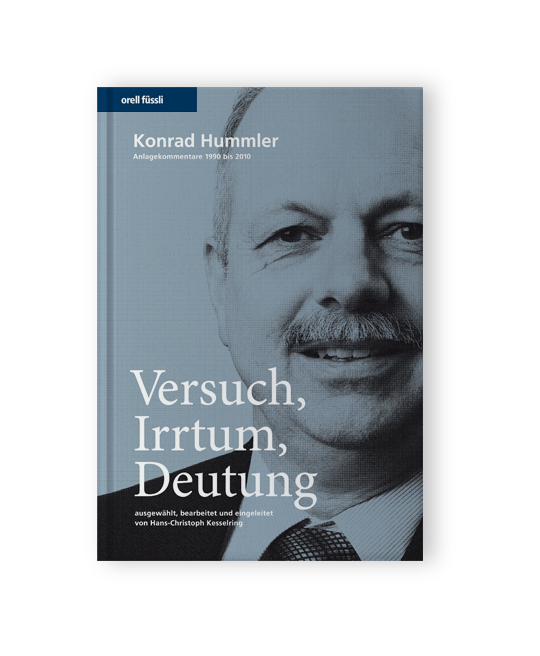








 Zur Übersicht
Zur Übersicht